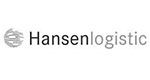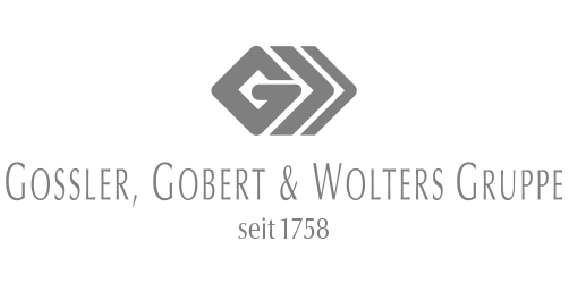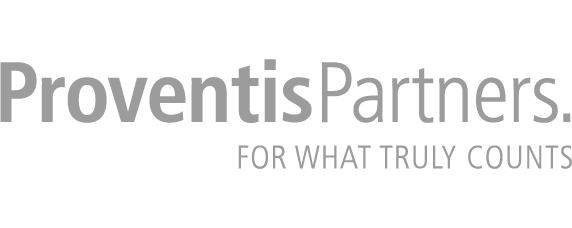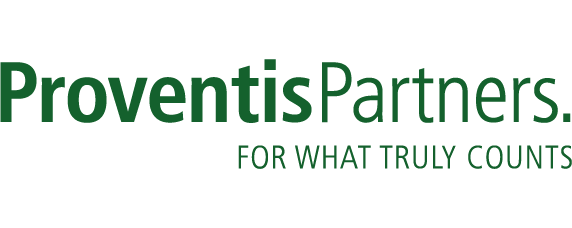Auch der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung setzt gleich im ersten Abschnitt ähnliche Schwerpunkte: "Für öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest", heißt es da. Neu zu entwickelnde Software soll als Open Source beauftragt und "grundsätzliche öffentlich gemacht" werden. Und der kommende Berliner Senat bezeichnet Open Source und offene Standards als unverzichtbar für eine digital souveräne Stadt.
Ein Weg, der sich schon lange abzeichnet
Neu ist das Interesse der öffentlichen Verwaltung an Open Source nicht. Seit 2002 verwendet das Städtchen Schwäbisch Hall Linux in den öffentlichen Einrichtungen. Die meisten Wellen schlug wohl das 2003 begonnene LiMux-Projekt in der Münchner Verwaltung. Dem Münchner Beispiel folgten andere europäische Großstädte wie Paris und Wien. Französische Regierungseinrichtungen schlossen sich bis 2010 vereinzelt dem Trend an, bevor die Regierung ab 2012 allen Behörden nahelegte, wann immer möglich auf Open Source zu setzen.
Wichtige Argumente: Kostenersparnis, aber vor allem Datensicherheit
Viele der anfänglichen Wechsel gerade in den Kommunen wurden durch die Aussicht, Kosten sparen zu können, motiviert. Das wurde zum Teil auch erreicht. So schätzt man in Schwäbisch-Hall bei 450 Arbeitsplätzen und einigen Dutzend Servern die jährliche Einsparung auf einen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich. Doch bei der aktuellen Entwicklung spricht niemand von Kosten. Stattdessen stehen die Begriffe Datensicherheit und digitale Souveränität im Vordergrund.
Diese Fokussierung dürfte vor allem auf die Verschiebungen im Verhältnis der Europäer zu den USA zurückzuführen sein. Das rabiate Verhalten der Amerikaner gegenüber der chinesischen Konkurrenz spielt da hinein. Denn auch die Verbündeten sollen unter Androhung von Sanktionen keine chinesische Technik einsetzen. Zudem strömen durch Microsoft, Google, Amazon, Facebook europäische Daten in amerikanische Rechenzentren, wo sie vor allem der US-Konkurrenz helfen, aber nicht den Europäern. Dass sich der Staat dagegen verwahrt, verwundert nicht. Das Projekt einer "digital souveränen deutschen Verwaltungscloud", wie es Schleswig-Holsteins Digitalminister Albrecht nennt, wirkt da eher wie eine Notwendigkeit.
Open Source als Selbstläufer?
Neben den hehren Zielen von Souveränität und Sicherheit treiben auch ganz praktische Erwägungen das Projekt des Umbaus. In einem Bericht der Landesregierung von Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2020 liest sich das wie eine Kritik an der Falle, in der die öffentliche IT steckt: "Die öffentliche Verwaltung benötigt zur Erledigung ihrer Aufgaben verlässliche Software, deren Anschaffung die Wahlfreiheit, Anpassungsmöglichkeiten und Wettbewerb gewährleistet und deren Betrieb die umfassende Kontrolle über die eigene digitale Infrastruktur gewährleistet."
Die Bewegung Richtung Open Source ist jedoch keine Einbahnstraße. Rückschläge gibt es auch. Während die 2017 beschlossene Rolle rückwärts zu Microsoft in München als politische Entscheidung gelten muss, ging die Umstellung beim Auswärtigen Amt, wo zwischen 2007 und 2011 mit Open Source gearbeitet wurde, schlicht schief. Dem Vernehmen nach fühlten sich die Beamten vor allem in den Auslandsvertretungen von ihrer IT alleingelassen und vermissten die gewohnten Programme.
Trendsetter Schleswig-Holstein
Doch trotz einzelner Volten wird es beim Umbau weg von proprietärer Software bleiben. Dataport, der IT-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung in Schleswig-Holstein, bündelt im Projekt Phoenix Software und zeigt, wo die Entwicklung hingehen könnte: eine Browser-gestützte Office-Suite auf Basis von LibreOffice und Collabora, Matrix-basierte Programme für das Messaging, OpenXchange als Mail- und Groupware-Server, Nextcloud als Kollaborationsplattform und Jitsi für Video-Konferenzen.